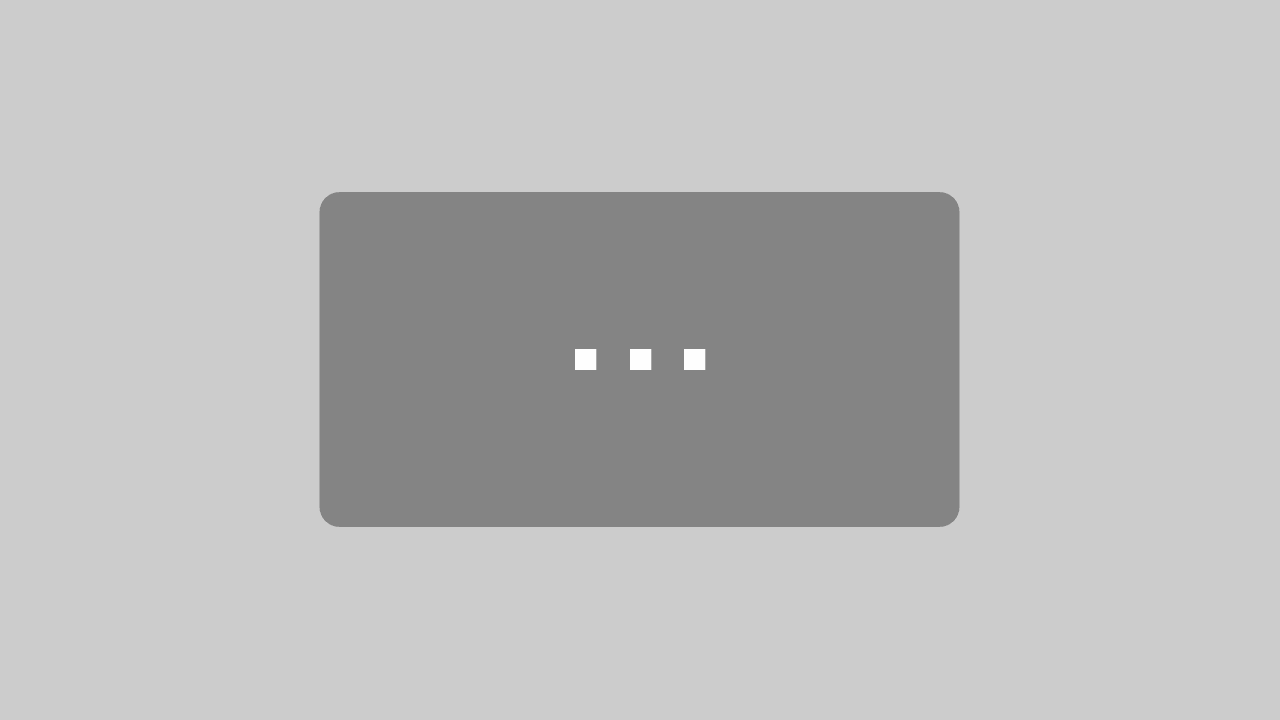Für selbstständige Unternehmer kann ein Firmenwagen ein Statussymbol und praktisches Werkzeug zugleich sein. Doch lohnt sich die Investition? Neben repräsentativen Vorteilen spielen auch ökonomische Überlegungen eine Rolle. Zudem können bei der Entscheidung auch Nachhaltigkeitsaspekte und die Flexibilität des Unternehmens bedacht werden, um eine Balance zwischen professioneller Außendarstellung und kosteneffizienter Mobilität zu finden.
Recht trifft Steuer: Der Teufel steckt im Detail
Die Anschaffung eines Firmenwagens kann per Kauf, Leasing oder Finanzierung erfolgen. Je nach Umfang der Nutzung kann das Fahrzeug dem Betriebsvermögen zugeordnet werden mit entsprechenden Abschreibungsmöglichkeiten über mehrere Jahre. Beim Leasing können die monatlichen Raten sofort als Betriebsausgaben absetzbar sein. Für wen sich welche Option eignet, hängt von Liquidität und Unternehmensstrategie ab. Leasing kann etwa für schnell wachsende Start-ups sinnvoll sein, um Kapital zu schonen.
Grünes Signal: Ökologische und ökonomische Synergien
Elektro- und Hybridfahrzeuge können vor allem durch geringere Betriebskosten langfristig kosteneffektiver sein. Zum Beispiel kann ein Elektrofahrzeug, das 40.000 Euro kostet und mit einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern genutzt wird, im Vergleich zu einem Benzinfahrzeug mit acht Litern Verbrauch auf 100 km über fünf Jahre gesehen mehrere tausend Euro an Energiekosten einsparen.
Buchhaltung auf Rädern: Ein-Prozent-Regelung vs. Fahrtenbuch
Bei der Ein-Prozent-Regelung wird monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises des Autos zum Zeitpunkt der Erstzulassung als geldwerter Vorteil für die private Nutzung versteuert. Das bedeutet, dass unabhängig von der tatsächlichen privaten Nutzung ein pauschaler Betrag versteuert wird. Dazu kommt die Besteuerung des Fahrtweges zur Arbeit mit 0,03 Prozent des Brutto-Listenpreises pro Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Diese Methode ist einfach zu handhaben, kann aber bei geringer privater Nutzung oder einem besonders teuren Fahrzeug zu höheren Steuerlasten führen.
Die Fahrtenbuchmethode verlangt eine akribische Aufzeichnung aller Fahrten mit Angaben zu Datum und Uhrzeiten zu jeder Fahrtstrecke, Kilometerstand, Reisezweck und den aufgesuchten Geschäftspartnern. Aus diesen Aufzeichnungen wird der Anteil der beruflichen zu privaten Fahrten berechnet und nur dieser Anteil wird als geldwerter Vorteil versteuert. Diese Methode ist genau, aber aufwendig und lohnt sich vor allem, wenn das Fahrzeug überwiegend geschäftlich genutzt wird.
Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Umständen und Wünschen ab und sollte im Hinblick auf die Steuerersparnis und den administrativen Aufwand sorgfältig abgewogen werden.
Wissen ist Macht: Beratungsressourcen für Unternehmer
Selbstständige sollten sich auch in Sachen Mobilität nicht auf eigene Faust durch den Steuerdschungel kämpfen. Fachkundige Beratung durch Steuerberater oder Finanzexperten ist unerlässlich. Branchenverbände, IHK und HWK bieten Informationsveranstaltungen und Beratungsgespräche an, um passende Mobilitätslösungen zu finden.
Titelbild: © Konstiantyn/stock.adobe.com