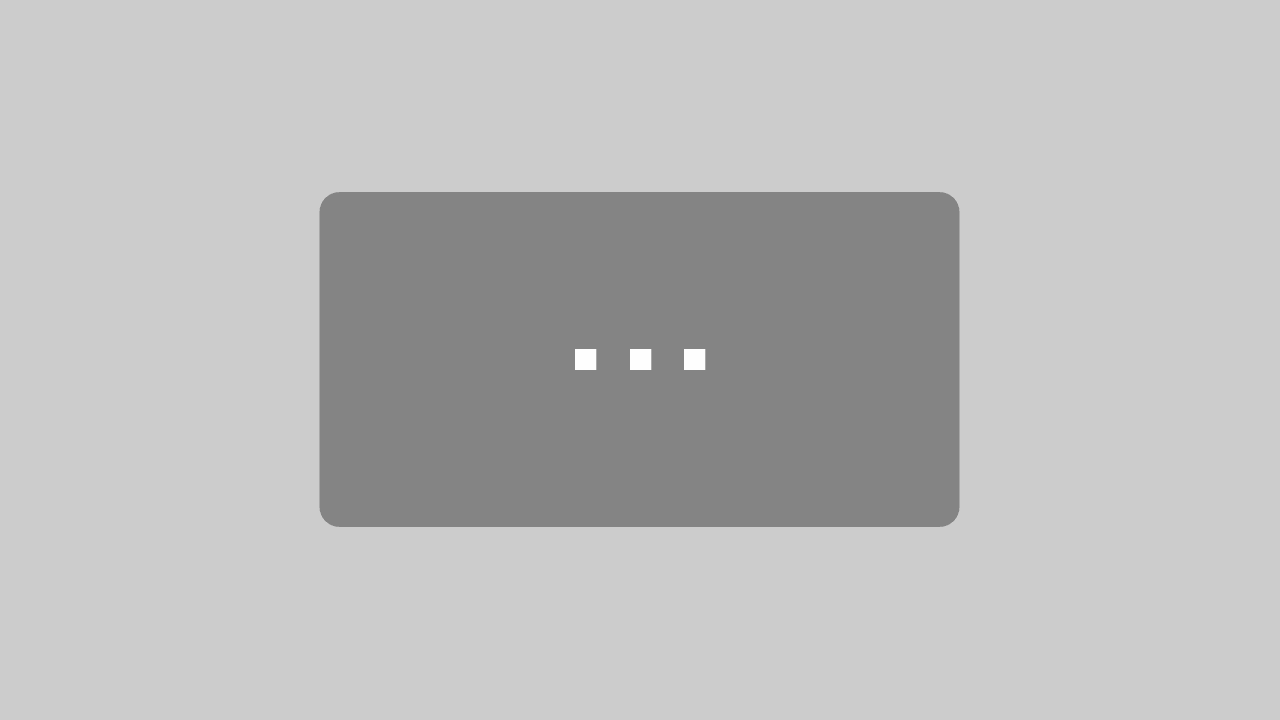Eine Gemeinschaft lebt von Freiwilligenarbeit. Gerade aktuell, aufgrund der Situation in der Ukraine, braucht die Gesellschaft sie mehr denn je. Doch leisten sie nicht nur in Krisenzeiten einen großen Dienst. Anlässlich des 20. Aprils – dem Tag der Anerkennung von Freiwilligen – schenken wir ihnen besondere Beachtung.
Woher stammt die „Freiwilligkeit“?
„Freiwillig”, bedeutet laut Duden, aus eigenem freien Willen geschehend. Wenn der Mensch etwas freiwillig tut, dann handelt es sich in der Regel um Dinge, die einem selbst gut tun und keine zu große Anstrengung erfordern. Umso bemerkenswerter, wenn Menschen sich einem freiwilligen Dienst hingeben, der nicht ihnen, sondern der Gesellschaft nützt und einem selbst dabei noch einiges abverlangt. Dabei entstand die Freiwilligenarbeit ursprünglich aus der Not heraus. Nach dem ersten Weltkrieg, in den 1920er Jahren, reisten Menschen aus ganz Europa an ehemalige Kriegsschauplätze, um der dortigen Bevölkerung beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Neben kirchlichen Organisationen bildeten sich erste zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich – auch über die regionalen Grenzen hinaus – für das Wohl anderer engagierten.
Da nach dem Krieg der Militärdienst untersagt war, entwickelten sich ebenfalls um diese Zeit die Frühformen des Zivildienstes, beziehungsweise des freiwilligen sozialen Jahrs. Während die Tätigkeiten, Deeptravel zufolge, zunächst nicht verpflichten waren, führte die Weltwirtschaftskrise gegen Ende der 1920er zu einer verpflichtenden Beschäftigungsmaßnahme für Arbeitslose. Eine Entwicklung, die schließlich ins Negative rutschte, da diese Form der Zwangsarbeit den aufkeimenden Nationalsozialismus in Deutschland wie auch Österreich stärkte. Nach dem zweiten Weltkrieg, ein Ereignis, das erneut ebenfalls viele freiwillige Helfer für den Wiederaufbau forderte, bildeten sich erstmals Dachverbände für Freiwilligenarbeit. Für sie stand wieder – auf lokaler wie internationaler Ebene – das freiwillige Helfen für den gemeinschaftlichen Nutzen im Vordergrund.
Die Pflicht zur Freiwilligkeit
Die Grundidee des Zivildienstes hatte bestand und kehrte zurück. So leisteten seit 1961 insgesamt rund 2.718.360 deutsche Staatsbürger, anstelle der Wehrpflicht, Zivildienst. Im Jahr 2011 endete die gesetzlich vorgeschriebene Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst. An seine Stelle trat der Bundesfreiwilligendienst. In der Regel arbeiten die Freiwilligen hier ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen. „Er soll zivilgesellschaftlichen Einsatz ermöglichen und das lebenslange Lernen fördern. Der Dienst dauert mindestens sechs und höchstens 18 Monate“, fasst das Gabler Wirtschaftslexikon zusammen. Im März 2022 leisteten bundesweit 38.228 Männer und Frauen einen freiwilligen Dienst.
Das Ehrenamt liegt im Trend
Die Mehrheit der Deutschen macht dem ursprünglichen Namen – wir erinnern uns: aus eigenem freien Willen entscheidend – alle Ehre. Sie engagieren sich freiwillig, ganz ohne Verpflichtung. Im Jahr 2021 beschäftigten sich Statista zufolge 2021 16,24 Millionen Menschen ehrenamtlich. Die vorherrschenden Bereiche: Sportvereine, kirchliche Einrichtungen sowie soziale Hilfsorganisationen. Im Jahr 2020 zählten rund 15 Millionen Menschen (ab 14 Jahren) zur Gruppe der Ehrenamtlichen in Deutschland. Der Statistik zufolge engagierten sich jedoch vor allem älteren Menschen ehrenamtlich: Die Mehrheit war 50 Jahre oder älter. Knapp ein Fünftel 70 Jahre oder älter.
Die Ausnahme von der Regel: gesellschaftliche Krisen. Wie bereits im Ursprung der freiwilligen Hilfe (nach dem ersten Weltkrieg), zeigt sich gerade in gemeinsamer Not das soziale Engagement. So bildeten beispielsweise während der ersten Phase der Corona-Krise junge Menschen das Rückgrat der Gesellschaft. Sie engagierten sich digital oder kauften, wie auch die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler, für ältere Menschen ein, die zur Risikogruppe zählten. Während der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kamen „Flut-Touristen“ aus ganz Deutschland, die ihren Urlaub nutzten, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Und auch während der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine zeigt sich: Die Menschen halten zusammen. Auch innerhalb der Versicherungsbranche ergaben sich so einige Initiativen, die großen Anklang fanden. Beispiele, die zeigen: In der Krise sind sich einige Menschen ihrer ehrenamtlichen Verantwortung bewusst. Anerkennung gilt aber vor allem auch denen, die sich Tag für Tag wie selbstverständlich für die Gemeinschaft organisieren.
Titelbild: © natalialeb/stock.adobe.com